Ich habe immer schon fernab von der Zivilisation gelebt. In einem abgeschiedenen Kaff mitten in einem abgelegenen Land, in dem die Buchläden voller Schulbedarf, Modezeitschriften und vereinzelter Bestseller waren. Einmal kam – vermutlich aus Versehen – das Buch „Herbst in Peking“ von Boris Vian in eine dieser Buchhandlungen. Mein Vater kaufte es, ohne zu zögern. Er trug es nach Hause, als wäre es eine Rarität. Tatsächlich war es sogar in zweifacher Hinsicht eine Rarität: Zum einen handelte es sich bei diesem Roman um ein derart außergewöhnliches Werk, das ein prüder und geldgieriger Verleger in dieser Zeit niemals herausgegeben hätte, zum anderen ist es für mich unvorstellbar, welches Ausmaß an Verwirrung dieses Buch in jene Auslagen voller Bleistift-Spitzer, Farbstifte, Hefte, Stephen Kings und Hello Kittys bringen konnte. Ich war fasziniert von diesen Seiten und reiste gemeinsam mit dem Hauptdarsteller in einem absurden Autobus in jenen nicht existierenden Herbst, ohne Peking.
In den Buchläden am Ende des Universums gab es sonst nur Bücher, die kurz davor waren zu Staub zu zerfallen. Uralte Reliquien, die sich mehr und mehr mit Termiten füllten. Es waren durchaus gute Bücher, das schon, aber keines davon war jünger als die Buchhandlung selbst. Es gab nichts Aktuelles, als ob die Literatur eine Sache aus einer anderen Zeit wäre.
Jetzt lebe ich an einem anderen Ende, in einem Land, in dem eine andere Sprache gesprochen wird als die meine. Überall gibt es Bücher, zu denen ich keinen Zugang hatte, bis ich dieses starre Alphabet beherrschte. Und selbst jetzt, wo ich es kann, lese ich immer noch lieber Bücher in einer Sprache mit lateinischen Buchstaben. Selbst heute habe ich immer noch keinen Zugang zu diesen Büchern, denn ich „beherrsche“ noch nicht die Wirtschaft. Ich lebe an einem wirtschaftlichen Ende, an dem ich all die Büchern, die ich gerne lese würde, nicht kaufen kann.
Aus all diesen Gründen habe ich nur selten Bücher gekauft. Meine unsichtbare Bibliothek setzt sich aus Leihgaben und Diebesgut zusammen. Früher war sie voller Fotokopien. Heute sind es PDFs, legale und illegale, die im Cyberspace kursieren. Oder Bücher, die ich mir in dieser hervorragenden, öffentlichen Bibliothek ausleihe, bei der ich eingeschrieben und von der ich abhängig bin. An mir gewinnen die Verlage und die Schriftsteller lediglich eine Leserin. Die sich durch Begeisterung, Leidenschaft, Bewunderung erkenntlich zeigt, aber nicht finanziell, niemand gegenüber. Ein Leser mehr – wen interessiert das? So wie es um die Dinge steht, ist es nicht wichtig, Leser zu gewinnen, das einzige, was interessiert, sind die Käufer. Vor ein paar Monaten wurde in der spanischsprachigen Presse von einem Skandal berichtet: Eine ziemlich bekannte spanische Schriftstellerin beschwerte sich öffentlich darüber, das ihr Buch wesentlich häufiger illegal aus dem Netz „heruntergeladen“ wurde, als es verkauft wurde. Die Reaktionen ließen nicht auf sich warten. Ich schließe mich denjenigen an, die darauf hinweisen, wie gering jene Autorin doch die große Anzahl an Lesern wertschätzte, die so ihr Werk lesen konnten und es auf einem anderen Wege nicht getan hätten.
Denn dieser Weg gibt Menschen, die es aus den einen oder anderen Gründen sonst nicht getan hätten, die Möglichkeit, etwas zu lesen. Ich lobe und preise den Informationsfluss, den man von jedem Ende der Welt aus abrufen kann, sobald man sich nur mit einem Kabel ans Netz anschließt. Gäbe es diesen kulturellen Strom nicht, der mir Zugang zu all diesen gemeinnützigen, aber auch illegalen Seiten verschafft, würde ich wohl kaum lesen. Ich könnte mir nur ein, maximal zwei Bücher kaufen. Gäbe es nicht diesen literarischen „Robin-Hood“-Freund, wäre ich überhaupt nicht auf dem neuesten Stand. Gäbe es nicht diese Bibliothek oder jene andere, wäre ich weiterhin abgeschieden von der Welt. Aber es interessiert niemanden, dass ich mich der Welt nähere. Das stellt nämlich weder für die einen noch für die anderen irgendeine Form des Gewinns dar.
Und lasst uns gar nicht erst über Musik reden: Während ich das schreibe, höre ich eine Band namens Chinawoman, auf die ich niemals gekommen wäre, wenn sie nicht jemand auf seiner Facebook-Pinnwand geposted hätte und wenn ich sie nicht über irgendwelche Pfade des Internets weiterhin hören könnte.
Über genau solche Pfade reise ich nun zu diesem Herbst und zu diesem Peking, das eine Rarität war, in jenem abgeschiedenen Kaff und in jenem abgelegenen Land, in dem ich einen Großteil meines Lebens verbracht habe.
Übersetzung: Barbara Buxbaum

 Themen
Themen
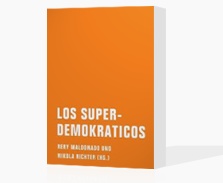



Excelente e inteligentes comentarios, como todo lo que escribe esta niña.
!Viva el amor al arte!
Los escritores deben vivir de la carga pública, y ser como la salud, la educación y la seguridad, mantenidos por el estado.