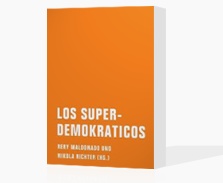Ein Kopf in Neukölln, im U-Bahnhof Boddinstr., Berlin, in einem sogenannten Problembezirk, wo die Mieten immer teurer werden. Foto: Anna-Esther Younes
Ich verbrachte Anfang der 1990er Jahre viel Zeit vor dem Fernseher. Ich sah Ice-T in New Jack City, ich sah Kids mit Butterfly-Messern und Neunmillimetern, die davon sprachen, dass sie raus mussten. In dem Film Sleepers sagt Robert De Niro zu seinen Kindern: „Ihr könnt es alle hier raus schaffen.“ Immer ging es ums Rauskommen. Ich lehnte zehnjährig an den Holzbalken vor dem Bolzplatz in meinem Viertel, wo überwiegend Lehrer wohnten, und spuckte auf den Boden. Ich wollte auch raus.
Zuerst versuchte ich mir einzureden, dass ich in einem urbanen Ghetto lebte, wie ich es aus dem US-Amerikanischen Film kannte und überredete meine Mutter mir Baggy Pants zu kaufen. Doch trotz der Graffitis auf den Hausfassaden in meiner Straße und trotz der Junkies hinter dem Bahnhof, musste ich mir eingestehen: Die meisten Bewohner hier hausten in großen, renovierten Altbauwohnungen mit Engeln und Sternen im Stuck.
Die Sehnsucht nach dem Leben urbaner Vorstadt-Kids aus den sechziger, siebziger, achtziger und neunziger Jahren in den Staaten mag eine unreife Projektion oder ein Akt unbewusster Subversion gewesen sein – heute glaube ich wirklich, dass wir in Ghettos leben. Nur sehen sie anders aus als im Fernsehen. Das Ghetto, in dem wir sozialisiert werden, ist ein Kopfghetto.
Ein imaginierter Raum für den Anderen. Ein Ort auf den er verwiesen wird und an dem er bleiben darf, solange er sich nicht rührt, solange er die Grenzen respektiert. Zum Beispiel muss ein Filmemacher aus einer türkischen Familie die Migrationsgeschichte oder die Heimat der Eltern thematisieren oder die angeblichen Konflikte zwischen den Kulturen. Er soll seiner Kategorie gerecht werden, in seinem Ghetto bleiben.
Im Kopfghetto bekommen Dinge einen Fetischcharakter: Jede Banalität – der Verzehr von (Schweine-)Fleisch, die Nutzung eines Baumwoll- oder Seidentuches als Kopfbedeckung, die Art der Begrüßung (Umarmung? Küsschen? Handschlag?) – bekommt eine fundamentale und mit anderen Dingen inkompatible Wichtigkeit. Und dann befinden wir uns mitten in einer Debatte darüber, ob bestimmte Kulturen miteinander existieren können. Dabei ist all das Gerede über (Schweine)Fleisch, Alkohol, Tücher nur ein zum Scheitern verurteilter Versuch, unsere Haltlosigkeit zu überspielen. In einer sich hybridisierenden Welt, wo Identitätskonturen zunehmend verschwimmen.
Das Ghetto wird größer als das Nicht-Ghetto. Es wächst mit der Vermehrung hybrider Identitäten. Und diejenigen, die versuchen, den Anderen in seinen Raum zu verweisen, sperren sich damit selber aus; sie bleiben provinziell in einer immer kosmopolitischeren Welt. Es gibt keinen Migranten-Film mehr, und es gibt auch keinen Nicht-Migranten-Film mehr, keine Migranten-Literatur und keine Nicht-Migrantenliteratur. Mit diesen Kategorien lässt sich nichts fassen. Von jeder mittelgroßen Stadt reichen Verbindungen in viele verschiedene Länder, überall. Diese Verbindungen reichen in die Erzählungen unserer Zeit hinein.
Circa 18 Jahre nach meiner Ghettosehnsucht auf dem Bolzplatz des mittelständischen Viertels, in dem ich aufgewachsen bin, sitze ich in Serdars Internet Café in Berlin-Neukölln und arbeite an einem seiner PCs. Kinder laufen ins Geschäft um saure Lakritzbretzeln und Cola-Weingummi zu kaufen oder Computer zu spielen. Ein kleiner Junge Namens Metin mit einer viel zu großen Hornbrille drückt mir ein Heft mit seinen neuesten, selbstgeschriebenen Science-Fiction-Geschichten in die Hand – bei ihm sind Aylin und Hazm gewöhnliche Namen Berliner Helden. Serdar will Feierabend machen und dreht das „Geöffnet“-Schild an der Glastür um. Metin sagt zu mir: „Jetzt steh endlich auf. Wir wollen doch alle bald raus hier.“

 Themen
Themen