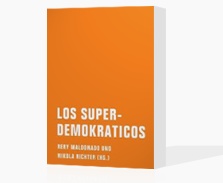Wie man aus der Wohnung, wo einer haust, und aus dem Stadtviertel, das er bewohnt, sich ein Bild von seiner Natur und Wesensart macht, hielt ich es mit den Tieren des Zoologischen Gartens.
(Walter Benjamin)
Zoologische Gärten sind Schnittstellen, die von dem Leben der eigenen mit der je anderen Art zeugen. Ihre Gestaltung spiegelt das Selbstverständnis einer Gesellschaft, die ihren Platz in der Evolution immer wieder neu definiert.
Beim Besuch eines Zoos verlangt es uns heute längst nicht mehr nach einem Abbild symbolischer Ordnung, wie sie noch die Menagerie Ludwigs XIV. verkörperte. Dessen Baumeister Louis Le Vau ordnete die Gehege in sogenannten Logen an. Der absolutistischen Herrschaftsidee entsprechend, richtete er diese konzentrisch zum Betrachterstandpunkt des Sonnenkönigs aus.
Gerechte Hege erbaut uns heute mehr als gebaute Hegemonie. Nicht positivistischer Bildungshunger treibt uns, eher schon suchen wir in den Landschaftskulissen nach Reservaten der Sehnsucht. So hat sich das Projekt Zoo gleichsam invertiert: Künstlich bauen wir en détail wieder auf, was wir en gros zerstören.
Große Freigelände ersetzen einzelne Gehegebauten und versammeln Lebensgemeinschaften unterschiedlichster Klimazonen.
Dabei ist der Freigeländegedanke gar nicht so neu, wenn man sich an Carl Hagenbeck und seine Utopie eines Zoos ohne Gitter erinnert, die er in Stellingen bei Hamburg 1907 verwirklichte. Hagenbeck, der als Fischhändler in St. Pauli begann, als Tierhändler sein Geld verdiente, der mit seinen berühmtberüchtigten Völkerschauen sowie seinem Zirkus und den portablen Panoramen durch die ganze Welt tourte, hatte schon früh begriffen, worauf es beim Unterhaltungsunternehmen Zoo im 20. Jahrhundert ankam: paradiesische Verhältnisse.
Doch was sich scheinbar kohärent zu einem Bild fügt, fängt mit einem Felskettenimitat der Hochgebirge an und endet in einem japanischen Garten, ganz nach dem Vorbild eines Landschaftspasticcios.
Im Zoo existieren keine fließenden Übergänge, Regenwälder finden sich direkt neben pinguinalen Tierkühlhäusern mit Gletscherambiente, vom maritimen Streichelbecken geht es über eine Doppelschwingtür in die Trockenwüste, die, den Tagesablauf der nachtaktiven Wüstenbewohner umkehrend, zur Besuchszeit in mittägliche Dunkelheit getaucht ist.
Und nicht nur zieht der Zoo seine Grenzen zwischen Mensch und Tier, zumeist zieht er sie auch zwischen den Tieren, denn Freßfeindschaften stören doch letztlich sehr die Vorstellung vom Zooparadies, das keine Kampfarena – wie einst im antiken Rom – sein soll.
Menagerien sind theatralische Orte, nicht minder als es Theater, Kirchen, Tempel, Arenen oder Mausoleen sind. Einen definierten Parcours, kalkulierte Perspektiven, Sichtachsen, Aussichtsplattformen, all das berücksichtigt man bis heute auch bei der Ausstellungsarchitektur Zoo.
Mit den ersten Menagerien hat man schon praktiziert, was erst viel später auf den Begriff gebracht werden sollte: Globalisierung. Exotische Tiere waren immer auch Gastgeschenke der Kaiser und Könige und dienten der Repräsentation.
Repräsentationssinn beweist man indes auch heute wieder, wenn sich MGM eine kleine Population seines Symboltiers hält, hinter Glas, in den Casinohallen eines Hotels in Las Vegas.
Der Zoo bleibt ein gerissenes Gelände, gleichermaßen zerrissen wie raffiniert reißerisch. Kulisse einer Menschensehnsucht, eingebettet in eine Urbanität, die er vergessen machen soll, obgleich sie ihn erst ermöglicht.


 Themen
Themen