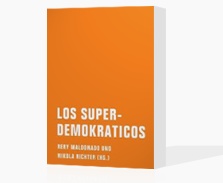In der vergangenen Woche habe ich viel Zeit mit einem Freund aus Amerika verbracht. Aus beiden Amerikas, wenn man so will. Javier ist Kolumbianer, lebt aber seit 16 Jahren in New York City. Er hat nicht vor, die Staaten jemals wieder zu verlassen. Im April ist er offiziell in den USA eingebürgert worden ist. Die Reise nach Berlin ist seine erste mit dem neuen Pass. Vorgestern hab ich ihn gefragt, ob er sich eigentlich mehr kolumbianisch oder mehr US-amerikanisch fühlt. Zu meiner Überraschung hat er nicht lange überlegt: „Ich bin US-Bürger“. „Inzwischen“, hat er dann angefügt.
Unsere gemeinsame Freundin Xenia, die aus Odessa am Schwarzen Meer stammt, genauso lange wie Javier in New York City lebt und ebenfalls die US-amerikanische Staatbürgerschaft hat, antwortet da immer etwas situationsabhängiger. Mal stellt sie sich als Russin vor, mal als Amerikanerin, manchmal als Ukrainerin. Je nach dem, was ihr passend erscheint. Sobald sie die Muttersprache ihres deutschen Ehemanns (und ihrer neuen Heimat) spricht, wird das ihre vierte Option werden. Das steht jetzt schon fest. Und irgendwie hätte sie damit auch Recht.
Ich fühle mich beiden darin eng verbunden. Das Thema Emigration begleitet mich mein halbes Leben – dabei hat es nur ein paar kurze Jahre lang eine konkrete Rolle gespielt. Doch der Schatten, den es damals auf mich und mein Dasein geworfen hat, ist bis heute riesig.
Seit ich fünfzehn war, hatte ich Pläne die DDR zu verlassen, seit ich siebzehn war, waren sie konkret. Ich wäre im Sommer 1990 ausgereist. So oder so. Aus der DDR auszureisen, bedeutete nicht einfach in ein anderes Land umzuziehen: Es bedeutete ganz und gar wegzugehen, seine Familie und die Freunde für immer zu verlassen. Vielleicht hätte ich keinen von ihnen jemals wieder gesehen. Ich wusste das. Es war der Preis meiner Freiheit. Ich kann bis heute nur ahnen, wie sehr ich unter der Trennung gelitten hätte.
Doch dann fiel 1989 die Mauer und ich musste nicht gehen. Ich war 18 Jahre alt, konnte studieren, konnte reisen, konnte selbst die Entscheidungen über mein Leben treffen. Und ich konnte all das tun, ohne meine Familie zu verlassen. Mir ist das Schlimmste erspart worden, und trotzdem ist in mir etwas geblieben von den geheimen Plänen damals, von der Jugend im isolierten Land, von den Träumen nach Freiheit, die sich nur in der Ferne unter Fremden verwirklichen kann.
Auf Reisen bin ich das frisch entkommene DDR-Kind geblieben, das glücklich und dankbar ist, wie durch ein Wunder doch noch die weite Welt sehen zu dürfen. Vor allem wenn ich in Amerika bin (im Süden genau wie im Norden), holt mich dieses Thema jedesmal ein. Nach wie vor. Eigentlich bewegt mich dort fast nichts anderes. Die Fremde, die Freiheit und das Leben. Ich kann gar nicht anders. Irgendwie habe ich den Fluchtinstinkt von damals bewahrt – oder werd ich ihn bloß nicht mehr los? Bin ich für immer ein Flüchtling, obwohl ich in Wahrheit nie einer war? Ich weiß es nicht.
In „Reise im Mondlicht“ (1937) lässt Antal Szerb seinen Protagonisten durch Venedig laufen und etwas fühlen, das ich sehr gut kenne: „Wenn er die Arme ausbreitete, konnte er links und rechts die Hauswände berühren, die schweigenden Häuser mit den großen dunklen Fenstern hinter denen sich, dachte er, geheimnisvolles und intensiv italienisches Leben abspielte.“ – genau diese Empfindung beherrscht auch mich, wenn ich in Amerika bin. Egal ob New York City oder Santiago de Chile. Ich laufe durch die Straßen, schaue fasziniert dem Leben dort zu (das dann natürlich nicht intensiv italienisch sondern intensiv chilenisch oder newyorkerisch oder was immer ist) und staune. Und dann fliegen in meinem Kopf plötzlich Bilder und Gedanken herum. Haarscharf am Logikzentrum vorbei und mit derselben Geschwindigkeit wie Landschaften am ICE… Ich bin dann stets verwirrt, aber auch stets erfüllt von tiefem Trost, wie ich ihn Zuhause selten fühle. Wenigstens für kurze Zeit bin ich dann voller Hoffnung, weil ich weiß, dass es einen Ort gibt, an den ich immer werde fliehen können, wenn es nötig werden sollte. Und das Leben am Ende immer einfach nur Leben ist.
Amerika war lange Jahre mein Licht am anderen Ufer. Es leuchtet immer noch. Und beruhigt mich. Es ist gut zu wissen, dass man weit weg gehen kann und immer noch da sein wird.

 Themen
Themen